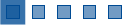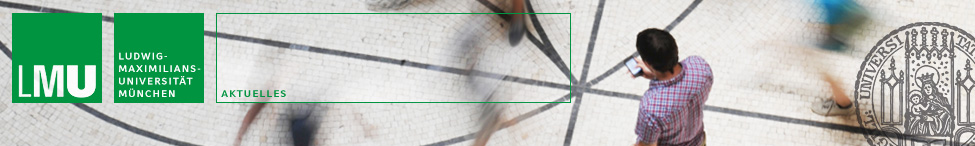
Zu Beginn der römischen Kaiserzeit hatte Griechenland angesichts der seit dem 2. Jh. v. Chr. voranschreitenden Provinzialisierung durch das römische Reich seine weltpolitische Bedeutung weitgehend eingebüßt. Die Zerstörungen im Zuge der Feldzüge des Mummius (146 v. Chr.) oder die Plünderung Athens durch Sulla (88 v. Chr.) setzten den politischen Ambitionen der alten griechischen Stadtstaaten und Städtebünde ein endgültiges Ende. Nichtsdestotrotz bewahrten sich die griechischen Provinzen Achaia und Macedonia während der römischen Kaiserzeit eine bemerkenswerte kulturelle Eigenständigkeit, in der die große Vergangenheit immer wieder eine beträchtliche Rolle spielte. Während sich einerseits römische Kolonien wie das aus den Trümmern der Zerstörung erst 46 v. Chr. neu gegründete Korinth sowie Patras als neue politische Faktoren etablierten, fungierte Athen als angesehenes akademisches Zentrum. Angesichts der zunehmenden Wertschätzung für die griechische Kultur der römischen Eliten während der Kaiserzeit gewann Griechenland eine neue Bedeutung, mit einem Kulminationspunkt unter Kaiser Hadrian. Diese kulturelle Konjunktur, die man als sog. zweite Sophistik bezeichnet, führte nicht nur zu einer literarischen und intellektuellen Orientierung an der Vergangenheit, sondern auch zu spezifischen Ausprägungen in der materiellen Kultur in den griechischen Provinzen. Die Vorlesung stellt Griechenland, zwischen Messene, Patras, Korinth, Athen und Thessaloniki, als Provinz des römischen Reiches vor, in der man zwischen Kaiserzeit und Spätantike in vielfältiger Weise das alte Erbe bewahrte, aufrief und neu kontextualisierte. Ferner sollen anhand der vorgestellten Befunde und literarischen Zeugnisse auch grundsätzliche Konzepte - wie etwa Romanisierung/Romanisation sowie Aneignungsprozesse und Resilienzfaktoren – zur historischen Interpretation.